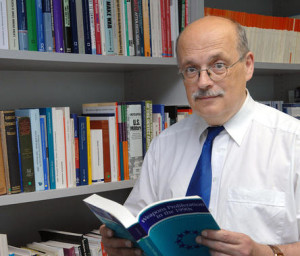Joachim Krause. Kant und seine Zeit — die Schrift „Zum ewigen Frieden“ vor der Hintergrund der Französischen Revolution und der nachfolgenden Kriege
Eine der heute bekanntesten und am häufigsten zitierten Schriften Immanuel Kants ist die zum Ewigen Frieden. Sie gilt als eine der wichtigsten politisch-philosophischen Schriften des großen Königsberger Philosophen. Kant setzte in diesen Schriften seine Überlegungen zur Philosophie und zur Ethik in mehr oder weniger konkrete Empfehlungen um. Die Schrift zum Ewigen Frieden stand aber lange im Schatten und galt als widerlegt. Erst in den 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts kam es zu einer breiten Neubelebung der Diskussion um diese Schrift, ausgelöst durch Artikel des amerikanischen Politikwissenschaftlers Michael Doyle (Doyle, 1983, 1986) sowie durch die 200. Wiederkehr des Erscheinens der Schrift 1995/1996.
Kant wird heute von vielen Autoren als der erste und wichtigste Philosoph hingestellt, der sich mit dem Friedensthema beschäftigt hat. Dabei wird er teilweise in einem Maße heroisiert, welches Kant persönlich unangenehm gewesen wäre. Ein typisches Beispiel ist der folgende Satz von Geismann: “Auf den hohen Schultern von Hobbes und Rousseau stehend sah der Rechtslehrer Kant in ein unabsehbar weites Land der Freiheit und des Friedens, dessen klare Konturen im Nebel der Weltanschauungen des 19. Jahrhunderts verschwanden, kaum dass sie aufgetaucht waren” (Geismann, 1982, S. 189).
Mit der Heroisierung geht zumeist der Versuch einher, Kant als Kronzeugen für Argumente in heutigen Debatten zu instrumentalisieren. Er wird gerne als Vorkämpfer des Völkerrechts in Anspruch genommen und auch für unterschiedliche politikwissenschaftliche „Schulen” reklamiert. Andere sehen in ihm primär den ersten Theoretiker des demokratischen Friedens. All diese Vereinnahmungen wären ihm vermutlich nicht genehm. Die Schrift zum Ewigen Frieden handelt nicht nur vom Völkerrecht und nicht nur vom demokratischen Frieden — sie handelt von beiden und versucht gerade die Kombination beider Ideen aufzugreifen.
Die Tendenz zur Heroisierung der Schrift und ihres Verfassers und der damit einhergehenden Instrumentalisierung (für wissenschaftliche oder politische Debatten) ist keinesfalls eine Besonderheit der heutigen Zeit. Die Schrift zum Ewigen Frieden wurde während des 1. Weltkriegs wiederholt zur Begründung deutscher Kriegsziele herangezogen (Hoeres, 2002) und diente in der Weimarer Republik als Begründung zur Kritik an dem Friedensvertrag von Versailles (Kater, 1999). Die Schrift wurde von Kritikern der amerikanischen Besetzung des Iraks im Frühjahr 2003 als Beleg für das Fehlverhalten der Bush-Administration angeführt (Kagan, 2003). Umgekehrt wurde Kant von amerikanischen Neo-Konservativen als Beispiel eines realitätsfremden Idealisten aufgeführt. Weder die eine noch die andere Charakterisierung dürfte Kant gerecht werden.
Die Friedenswahrung war für Kant ein Thema der angewandten Aufklärung. Von daher muss diese Schrift anders gelesen werden als seine kritischen Schriften. Kant war ein Philosoph der Aufklärung, und Aufklärung bedeutete für Kant den Ausgang aus selbst verschuldeter Unmündigkeit. Für ihn war die Aufklärung ein permanenter, durchaus dialektisch zu verstehender Prozess, bei dem gute Ideen mit der Realität konfrontiert werden und entweder scheitern oder weiter entwickelt werden. Von daher empfiehlt es sich, jede ernsthafte Auseinandersetzung mit der Schrift zum Ewigen Frieden damit beginnen zu lassen, dass diese in ihrem zeitlichen Kontext verortet wird. Das will ich heute versuchen und im Einzelnen fragen: was waren die diskursiven und die konkreten historischen Hintergründe, vor denen die Schrift zu sehen ist? Was war der konkrete Beitrag, den Kant mit dieser Schrift zur Lösung der damals bestehenden Probleme leisten wollte? In welcher Weise hat diese Schrift dazu beigetragen, die Friedensproblematik voranzubringen. Es heißt aber auch, zu fragen, welche Kritik dagegen vorgebracht worden ist, und wie berechtigt oder unberechtigt diese Kritik war. Dabei gelange ich zu folgenden Ergebnissen, die ich ihn 8 Punkten zusammenfasse:
1. Im Gegensatz zu einer heute weit verbreiteten Meinung unter den Kant-Forschern stellt die Schrift Kants zum Ewigen Frieden keinesfalls den Beginn der neuzeitlichen philosophischen Befassung mit der Frage von Krieg und Frieden dar, sondern setzt vor dem Hintergrund der französischen Revolution die lebhafte intellektuelle und auch politische Debatte des 18. Jahrhunderts zu diesem Thema fort.
Die Schrift zum Ewigen Frieden enthält wenig Neues, zumeist arbeitet Kant mit Standardargumenten der Philosophen der Aufklärung des 18. Jahrhundert. Neu ist bei Kant aber die Systematisierung. Im Gegensatz zu einem immer wieder anzutreffenden Missverständnis war das 18. Jahrhundert durch eine Vielzahl von Beiträgen zur Friedensproblematik gekennzeichnet, die teils von etablierten Philosophen (wie Montesquieu, Rousseau, Voltaire), teils von Schriftstellern oder anderen Persönlichkeiten stammten (Bahner, 1965; Beutin, 1996). Diese Debatten hatten noch wenig Einfluss auf die hohe Politik, aber es gab durchaus schon Prozesse der wechselseitigen Beeinflussung. Es gab damals drei große Denkrichtungen: das Gleichgewichtsdenken, die Forderung nach einem Staatenbund und die These, wonach Frieden unter Monarchien nicht möglich seien, weil nur Republiken Frieden wahren könnten. Der Theorie der friedenssichernden Funktion des Gleichgewichts konnte Kant wenig abgewinnen, sie galt auch Ende des 18. Jahrhunderts weitgehend als widerlegt (Kaeber, 1971). Die Forderung nach einem Staatenbund war 1713 von dem Abbé de St. Pierre in einer weit beachteten Schrift aufgestellt worden (Saint Pierre, 1922). Die These, wonach Frieden nur unter Republiken gewahrt werden könne, hatte 1748 zum ersten Mal Charles Baron des Montesquieu aufgestellt, im neunten Buch seines berühmten Werkes vom Geist der Gesetze. Beide Theorien nahm Kant auf und — so wie vor ihm Montesquieu — versuchte er sie miteinander zu kombinieren. Montesquieu hatte geschrieben, dass nur Republiken einen dem Frieden verpflichteten Staatenbund bilden könnten (Montesquieu, 1992, S. 182), er hatte aber auch die damals weit verbreitete Ansicht vertreten, dass Republiken nur in kleinen politischen Gemeinschaften (hauptsächlich Städte) realisierbar wären. Das engte die Möglichkeiten eines ewigen Friedens ein, es klang nach Verliererkoalitionen.
2. Kants Schrift zum Ewigen Frieden erschien 1795 zu einem Zeitpunkt, wo aufgrund des Verlaufs der französischen Revolution die von Montesquieu stammende Perspektive des republikanischen Friedens sich neu stellte.
Mit der Begründung einer Republik in einem Territorialstaat (und vor allem auch noch im einflussreichsten Staat Europas) verband sich für Kant die Hoffnung, dass sich das von Montesquieu aufgezeigte Dilemma (Republiken sichern am ehesten den Frieden, aber die republikanische Regierungsform lässt sich dauerhaft nur in Stadtstaaten herstellen) nunmehr auflösen könnte und dass es mehr Republiken geben würde. Die gleichzeitige Transformation der Vereinigten Staaten von Amerika zu einer großen Republik schien diese Erwartung zu bestätigen. Damit eröffnete sich die Perspektive einer radikalen, positiven Veränderung der zwischenstaatlichen Beziehungen (Brandt, 2004, S. 140). Allerdings war Kants Schrift nicht nur von Optimismus gekennzeichnet, sondern auch von Pessimismus. Dafür gab es eine Ursache: der republikanische Flächenstaat Frankreich war im Gegensatz zu den Erwartungen vieler Aufklärer alles andere als friedfertig. Kant sah dieses Problem, aber er wollte nicht in die gleiche Richtung argumentieren wie Edmund Burke. Dieser hatte schon 1790 behauptet, dass etwas grundsätzlich falsch gelaufen sei mit der französischen Revolution, die als Anwendung der Lehren der Aufklärung galt (Burke, 1790). Mit der Kritik Burkes — die lebhaften Anklang auch in Deutschland fand — verband sich aus der Sicht Kants die Gefahr, dass das Projekt der Aufklärung insgesamt in Frage gestellt wird. Die Schrift Kants zum Ewigen Frieden muss in dieser Lage als Versuch interpretiert werden, die zentralen Ideen der Aufklärung zum Frieden davor zu bewahren, dass sie in den Sog der sich an dem Scheitern der Französischen Revolution festmachenden Aufklärungskritik geraten. Gleichzeitig versuchte er mit dieser Schrift, die Ideen der Aufklärung zum dauerhaften Frieden an die veränderten politischen Bedingungen anzupassen und auch kritikwürdige Aspekte der französischen Politik aufzugreifen. Geht man die Schrift von diesem Standpunkt aus an, so erschließt sich die Systematik und der Gesamtzusammenhang des Papiers in einer ganz anderen Weise als bei den meisten Kant-Interpretationen.
Kant wiederholte in den beiden ersten Definitivartikeln im Wesentlichen das, was Montesquieu und der Abbé St Pierre angedacht hatten. Wie St. Pierre ging er davon aus, dass die Staaten ihre Probleme friedlich miteinander besprechen und durch diplomatischen Ausgleich oder auch durch Mehrheitsentscheidungen lösen sollten. Dazu müsse ein Staatenbund geschaffen werden, der weitgehend St. Pierres Ideen widerspiegelte. Wie Montesquieu, Voltaire, Rousseau oder Paine sah Kant einen Staatenbund nur dann als realisierbar an, wenn Monarchien abgeschafft werden und es nur noch Republiken gab. Kant argumentierte, dass Republiken friedlicher sein werden als Monarchien, da in ihnen diejenigen Bürger über Krieg und Frieden zu entscheiden hätten, die später auch die Folgen eines Krieges zu tragen hätten. Mit den Präliminarartikel wie mit dem dritten Definitivartikel wollte er aufzeigen auf, dass es nicht ausreicht, einen dauerhaften Frieden nur auf der Existenz von Republiken und des Staatenbundes zu begründen, sondern dass eine Ethik des Friedens unerlässlich sei. Geht man die einzelnen Präliminarartikel durch, dann wird deutlich, dass sie sich alle auf dringliche Probleme seiner Zeit bezogen und dass Kant mit ihnen auch indirekte Kritik an Frankreich ausübte. Fragt man, was Kant mit seiner Schrift zu dieser Zeit bewirkt hat, dann stellt sich allerdings Ernüchterung ein.
Der erste Präliminärartikel besagte, dass kein Friede als solcher gelten solle, welcher in der Absicht geschlossen werde, ihn später zu brechen (Kant, 1795, S. 343). Diese Formel reflektierte Kants Sorge, dass der gerade geschlossene Friede von Basel zwischen Preußen und Frankreich vom April 1795 nicht lange halten würde. Das war klug beobachtet und der Rat war gut gemeint. Aber: in den kommenden Jahren erwies sich das republikanische Frankreich als sehr viel aggressiver als die damaligen Monarchien und die Franzosen trachteten mit teilweise größerem Eifer nach der Kontrolle fremder Territorien als die feudalen Herrscher. Das sollte sich vor allem unter Napoleon zeigen.
Dem letztgenannten Problem sollte auch der zweite Präliminärartikel gerecht werden, welcher besagte, dass kein Staat von einem anderen durch Erbe, Tausch, Kauf oder Schenkung erworben werden dürfe (Kant, 1795, S. 344). Dies hatte schon der Abbé St. Pierre 1713 gefordert. Bei Kant stellte dies eine deutliche Kritik an der kurz zuvor erfolgten Aufteilung Polens unter Preußen, Österreich und Russland dar. Aber auch der Frieden von Basel musste damit gemeint sein, denn er regelte unter anderem, dass Frankreich das gesamte linksrheinische Gebiet zugesprochen bekam, ohne dass die betroffene Bevölkerung eine Möglichkeit der Mitbestimmung besaß.
Der dritte Präliminärartikel enthielt die Forderung nach Abschaffung ständiger Heere (Kant, 1795, S. 345). Auch hier griff Kant auf den Abbé St. Pierre zurück. Tatsächlich stellte dieser Artikel eine Kritik der französischen Wehrpflicht dar. Die massenweise Aushebung von Rekruten und die damit verbundene dauerhafte Präsenz eines großen französischen Heeres hatte nach anfänglichen Schwierigkeiten die militärische Kräftebalance in Europa durcheinander gewirbelt und förderte in der französischen Republik weitere Eroberungspläne. Die anderen Mächte arbeiteten mit Berufssoldaten, was dazu beitrug, dass ihre Armeen kleiner und ihre Soldaten weniger motiviert waren als diejenigen Frankreichs. Kant hatte dieses Problem erkannt und wollte es normativ lösen, indem es in einer Welt republikanisch geordneter Staaten keine stehenden Heere mehr geben sollte. Das war ein Rat an die französische Republik, Vorsicht und Einsicht walten zu lassen, vor allem in einer von ihm erwarteten europäischen Lage, wo es mehr und mehr Republiken geben sollte. Der Rat verfehlte aber seine Wirkung. Nach 1795 sollte sich das enorme Potenzial Frankreichs zur Massenweisen Aushebung von Rekruten erst richtig entfalten — und zunehmend auch Männer von außerhalb Frankreichs einbeziehen.
Der vierte Präliminärartikel enthielt die Forderung, dass keine Schulden in Bezug auf äußere Händel, vor allem Kriege, gemacht werden sollten (Kant, 1795, S. 345). Das war eine wirklich neue Idee. In Großbritannien und in den kontinentaleuropäischen Ländern, und leider auch in Frankreich, war es üblich geworden, Kriege durch die Ausgabe von Schuldanleihen zu finanzieren. Je länger die Kriege dauerten, umso größer wurden die Schulden und umso mehr versuchten die Großmächte dann, die Schulden dadurch abzutragen, dass sie kleinere Staaten annektierten, was Anlass zu neuen Kriegen geben musste. Auch diese Forderung Kants verfehlte ihre Wirkung und unter Napoleon wurde alles noch schlimmer: Bei ihm wurden Kriege durch Schulden finanziert, die teilweise erst mit der Beute des darauf folgenden Krieges zurückgezahlt werden konnten. Die Gefahr der Perpetuierung des Kriegeszustands durch Schuldenaufnahme sah Kant mit großer Klarheit, wenngleich er noch nicht die Methoden Napoleons kannte.
Auch der fünfte Präliminarartikel beruhte auf St. Pierres Schrift von 1713 und nahm die Kritik an der Politik der Republik Frankreich auf. Kant forderte, dass sich kein Staat in die Verfassung und Regierung eines anderen Staates einmischen soll (Kant, 1795, S. 346). In einer Zeit, in der die französische Nationalversammlung offen dazu aufrief, die Regierungen anderen Länder zu stürzen -sei es durch Revolution, sei es durch Intervention — war das eine mutige Forderung, die zu seiner Zeit auch nicht von allen Zeitgenossen Kants geteilt wurde. Auch diese Forderung fand in den Folgejahren keine Beachtung. Unter Napoleon gab es in Kontinentaleuropa nur ein Machtzentrum, dieses mischte sich in die Angelegenheiten jedes einzelnen Landes ein.
Der sechste Präliminärartikel war weniger an Frankreich gerichtet als an alle Regierungen generell. In ihm wird gefordert, dass sich kein Staat im Kriege solche Feindseligkeiten erlauben solle, dass darüber später kein Friede geschlossen werden könne, wozu er Meuchelmord, Giftmischerei, Friedensbruch und ähnliches zählte (Kant, 1795, S. 346). Dieser Gedanke war auch nicht gerade neu, er leuchtet ein und man findet ihn später bei Clausewitz (Clausewitz, 1867, Bd. 3, S. 116).
Unter den Definitivartikeln, die den harten theoretischen Kern von Kants Schrift zum Ewigen Frieden darstellen, war nur seine Forderung nach einem Weltbürgerrecht auf Hospitalität neu. Dieser Definitivartikel muss im Zusammenhang mit Kants Abrücken von der Idee eines Weltstaates gesehen werden. Bis zur französischen Revolution hatte er einen Weltstaat zumindest im Prinzip befürwortet, weil dieser die Macht der Monarchien einschränken könnte. Mit der Revolution eröffnete sich für ihn die Perspektive, dass nicht nur Frankreich sondern auch andere Staaten Europas zu Republiken werden. Damit stellte sich nicht mehr die Frage des Weltstaates, sondern die des Miteinanders von Republiken. Dafür war das Recht auf Hospitalität gedacht. Jeder Mensch sollte überall auf der Welt das Recht haben, nicht feindselig behandelt zu werden. Dieses Recht auf Hospitalität enthielt auch eine eher indirekte Kritik am Kolonialismus der europäischen Mächte und am Festhalten des revolutionären Frankreichs an seinen Überseebesitzungen und an der dort praktizierten Sklaverei. Kant interpretierte das Recht auf Hospitalität so, dass man sich in fremden Ländern nicht als Eroberer aufspielen dürfe.
Dass die Aufstellung von normativen Forderungen nicht die Dynamik der französischen Republik binnen kurzer Frist beeinflussen konnte, dürfte Kant bewusst gewesen sein. Er setzte auf die mittel- oder langfristige Wirkung seiner Ideen. In den beiden Zusatzartikeln hat er dafür die Begründung geliefert. Der erste läuft darauf hinaus, dass im Laufe der Zeit sich seine Ethik durchsetzen werde als „tiefliegende Weisheit einer höheren, auf den objektiven Endzweck des menschlichen Geschlechts gerichteten und diesen Weltlauf prädeterminierenden Ursache, Vorsehung genannt…” (Kant, 1795, S. 346).
3. Kants Hoffnungen und Erwartungen erfüllten sich nicht. Zwar wurde die Schrift in Frankreich positiv aufgenommen, aber in der politischen Realität der Jahre zwischen 1795 und 1815 entwickelten sich die Dinge völlig anders als Kant es erwartet hatte.
Weder erfüllten sich die hohen Erwartungen an Frankreich noch bildeten sich andere, unabhängige Republiken. Nach 1795 mehrten sich vielmehr die Zeichen, dass die Republik Frankreich selber zur treibenden Kraft für weitere militärische Abenteuer wurde. Im Jahre 1799 war das französische Demokratieexperiment am Ende, die Macht wurde einem energischen und Machtbewussten General überlassen — Napoleon Bonaparte. Dieser ließ sich 1804 auch noch zum Kaiser Frankreichs ausrufen und verausgabte sich und sein Land in einem Feldzug nach dem anderen. Ungefähr viereinhalb Millionen Todesopfer forderten die durch Napoleon angestifteten Kriege, viel mehr als alle monarchischen Kabinettskriege des 18. Jahrhunderts zusammen. Der Grund dafür war: Napoleon wollte seine Gegner völlig schlagen, nicht nur Voraussetzungen für bessere Verhandlungslösungen schaffen. Er wollte sich nicht mit halben Lösungen zufrieden geben, sondern hauptsächlich siegen. Unter ihm wurde es wieder üblich, dass sein umherziehendes Heer sich aus der Landschaft „bediente”, wie es damals hieß. Das bedeutete, dass die Bevölkerung fremder Länder — wie zuletzt im Dreißigjährigen Krieg — von der Soldateska Napoleons hemmungslos ausgebeutet wurde. Bis dahin hatte es eine stillschweigende Übereinkunft unter den Fürsten Europas gegeben, Feldzüge nicht mehr auf der Basis der Auspressung der Zivilbevölkerung vorzunehmen, sondern für die eigenen Truppen eine logistische Versorgung zu schaffen. Dieser kleine zivilisatorische Fortschritt war dahin, denn er stand den Plänen Napoleons entgegen, große Heere aufzustellen, mit denen er seine Gegner entscheidend schlagen konnte. Napoleon trieb sein Unwesen bis 1813, als er infolge der Russlandinvasion geschwächt war und 1814 bzw. erneut 1815 entscheidend geschlagen wurde.
4. Es war der frühere Kant-Schüler Friedrich Gentz, der die Schwachstellen der Kantschen Überlegungen (insbesondere die Idee des republikanischen Friedens) herausarbeitete und eine Theorie des demokratischen Kriegs entwickelte, die weitaus mehr Relevanz zur Erklärung der Politik im frühem 19. Jahrhundert hatte als Kants Theorie.
Gentz argumentierte, dass die Revolution die Relativierung aller Werte bewirkt und zu einer Herrschaft der nackten Gewalt geführt habe. „Die Französische Revolution”, so Gentz, „hat die militärische Macht von neuem über alle anderen erhoben und einen Zustand herbeigeführt, in welchem das Schwert fast allein das Schicksal der Nationen bestimmt” (Gentz, 1992, S. 495). Und nicht nur das: die französische Republik habe gezeigt, dass die damit verbundenen Ideen der Freiheit und des Nationalismus ganz neue Reservoirs der Kriegsbereitschaft und Kriegsführungsfähigkeit entstehen lassen. Die Menschen, so Gentz, seien bereit für Ideale der Freiheit und der Nation viel mehr Gewalttaten — und viel grausamere — zu begehen als zu Zeiten der Kabinettskriege. Nicht nur dass Kriege verbissener und mit mehr Grausamkeit geführt werden, sie würden in Republiken auch nicht zu einer raschen Erschöpfung der Kräfte beitragen (was bei Monarchien regelmäßig eintrete). Auch beobachtete Gentz, dass je länger das revolutionäre Frankreich im Krieg lag, umso mehr war es in der Lage zusätzliche Kräfte für die Fortführung der Kriege zu mobilisieren. Anstelle einer Erschöpfung der Kriegskräfte käme es zu deren Vervielfältigung (Gentz, 1992, S. 496). Zudem beobachtete er eine Verrohung der Sitten, eine „frevelhafte Unsittlichkeit”, die dazu führe, dass enorme Grausamkeiten begangen werden (Gentz, 1997, S. 214 ff.). Es sei absehbar, dass dieser Geist auch andere Völker anstecke und dadurch der Krieg eine völlig neue Dimension bekomme: aus einem wenig genutzten Instrument der Kabinettspolitik, welches zudem in der Regel mit Vorsicht und Zurückhaltung eingesetzt werde, entstehe eine neue Form der organisierten Gewalt, bei der alle Kräfte einer Nation mobilisiert werden und wo die Gewalt erst richtig im Verlaufe eines Krieges zur Entfaltung käme. Auf ganz Europa angewandt bedeutete das, dass es zu einem langwierigen und vernichtenden Krieg kommen werde, wenn das französische Beispiel auch in anderen Ländern Schule mache.
5. Kant und Gentz lagen in vielen Dingen beieinander, unterschiedlicher Meinung waren sie in der Frage der Friedensfähigkeit von Republiken.
Beide stimmten darin überein, dass es darauf ankomme, dass sich Staaten in ihren Beziehungen zueinander mäßigen und sich friedlich verhalten. Beide wollten Kriege vermeiden und beide gingen davon aus, dass die innere Verfassung von Staaten einen Einfluss darauf habe, ob sich diese friedlich oder kriegerisch verhalten. Kant sah die Schaffung von Republiken als die beste Garantie für die Erhaltung des Friedens an, Gentz sah das genau anders.
Gentz wollte der Gleichgewichtspolitik durchaus eine Rolle in der Friedenswahrung zuschreiben. Allerdings, so Gentz in einer 1800 veröffentlichten Schrift zum „ewigen Frieden“, solle man sich von der Gleichgewichtspolitik nicht zu viel erhoffen. Im Prinzip sei die Idee nicht schlecht und habe in der Vergangenheit den einen oder anderen Krieg beendet oder gar verhindert. Das Konzept dürfe allerdings nicht mechanistisch verstanden werden, sonst werde es wirkungslos. „Dieses System des politischen Gleichgewichts,“ so schrieb Gentz, „ist freilich mehr als einmal in den Händen des Ehrgeizes und der Selbstsucht zu einem Werkzeug der Zerstörung geworden und hat mehr als einmal den Krieg, den es zu hintertreiben vorgab, befördert“ (Gentz, 1992, S. 480). Damit hatte er Recht, denn in der Mitte des 18. Jahrhunderts war die bis 1730 von den führenden Mächten Europas mit einem gewissen Erfolg betriebene Politik der Kriegsverhinderung durch Gleichgewichtspolitik in ihr Gegenteil degeneriert.
6. Der Erste Weltkrieg war ein demokratischer Krieg und ließ alle Befürchtungen von Gentz wahr werden und Kants Theorie des demokratischen Friedens in Vergessenheit geraten.
Die verbissene Entschlossenheit der europäischen Nationalstaaten für die jeweils einzig richtige Sache zu kämpfen und diesen Kampf bis zur vollständigen Erschöpfung durchzuhalten, führte zu einem Krieg, an dessen Ende mehr als 10 Millionen Menschen getötet waren. Der Erste Weltkrieg war ein Krieg, der trotz bestehender institutioneller demokratischer Kontrollinstrumente und Mitwirkungsrechte der Bevölkerung ausbrach. Am deutlichsten war das im Deutschen Reich zu sehen, das über keine ausreichenden Steuereinnahmen verfügte, um einen Krieg zu finanzieren, und daher gleich zu Anfang Kriegskredite aufnehmen musste. Nicht nur dass der Reichstag die Aufnahme der Kriegskredite ausdrücklich billigte; auch die Bereitschaft in der Bevölkerung, diese Anleihen im großen Umfang zu zeichnen, war neben der allgegenwärtigen Kriegseuphorie ein klarer Indikator dafür, dass demokratische Institutionen oder die Mitsprachemöglichkeit der Bürger in keiner Weise die Kriegsbereitschaft herabsetzten. Im Gegenteil, zumindest in Deutschland war der Kriegsausbruch 1914 gewollt und in den anderen Ländern war die Lage nicht viel anders. Der Erste Weltkrieg war ein demokratischer Krieg, der die These Kants und anderer Philosophen vom republikanischen Frieden ad absurdum führte. Er war der bis dato schlimmste und verlustreichste Krieg der Weltgeschichte und bestätigte alle Befürchtungen von Gentz. Er wurde nur noch durch den Zweiten Weltkrieg übertroffen, der in gewisser Weise eine Fortsetzung des Ersten Weltkriegs war.
7. Erst die Zeitenwende nach dem Zweiten Weltkrieg hat einen grundsätzlichen Wandel im Umgang demokratischer Nationalstaaten Europas mit dem Friedensproblem gebracht.
Dies wurde weniger durch die Rückbesinnung auf Kant bewirkt, als vielmehr durch das massive Engagement der USA für die Wiederbelebung der Weltwirtschaft sowie die damit verbundene Einrichtung internationaler Organisationen und der Förderung von Demokratie. Dass dabei Gedanken wieder belebt worden, die auf aufklärerische Ideen des 18. Jahrhunderts (wozu auch Kant beigetragen hat) zurückgehen, ist der entsprechenden Tradition in den USA geschuldet. Zudem muss man anerkennen, dass durch die Schaffung des Sozialstaates und die Möglichkeiten des Freihandels nach dem Zweiten Weltkrieg bislang ungeahnte Potenziale freigesetzt wurden, die zur Pazifizierung der westlichen Gesellschaften führten: Erst seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts findet jene gesellschaftliche und politische Beruhigung statt, die zu einem Paradigmenwechsel in der Außen- und Verteidigungspolitik geführt hat. Die theoretische Begründung dafür wie man Demokratien dazu bringt, dass sie stabiler und damit friedlicher werden — sowohl im Umgang mit sich selbst als auch mit anderen — wurde weder von Gentz noch von Kant gegeben. Tatsächlich legten Denker wie Hegel, Lorenz von Stein (Stein, 1964) oder John Stuart Mill im 19. Jahrhundert und Max Weber, Joseph Schumpeter (Schumpeter, 1942), John Meynard Keynes, Harold Laski und auch William Beveridge im 20. Jahrhundert die Grundlagen für ein differenzierteres Verständnis der Stabilität (und damit der Legitimität und folglich der Friedfertigkeit) von Demokratien, bei dem die materielle Lage der breiten Massen und die Frage der sozialen Schichtung und Mobilität eine große Rolle spielten.
8. Mit der heutigen Lage könnten heute sowohl Kant als auch Gentz zufrieden sein — sofern sie noch leben würden.
Wer von beiden jetzt eher Recht hatte, darüber kann man sich streiten. Für Europa im gesamten 19. Jahrhundert und zumindest bis zum Ersten Weltkrieg muss man sagen, dass Gentz Recht hatte und Kant falsch lag. Ab den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts drehte sich das um. Heute gibt es Frieden unter den demokratischen Staaten Europas und dieser wird als Bestätigung der These von Kant gesehen, dass nur ein republikanischer Friede dauerhaft sei. Für Kant spricht, dass heute viele seiner Utopien Wirklichkeit geworden sind. Für Gentz spricht, dass er auf jene Probleme hingewiesen hat, die Kants Utopien seinerzeit im Wege standen und über die Kant recht großzügig hinweggeschaut hat. Den entscheidenden Wandel bewirkten diejenigen in Europa, die besser als Kant und Gentz die Bedingungen für demokratische Stabilität formulieren konnten und diejenigen in den USA, die einen neuen, demokratischen Stil der Außenpolitik bewirkten, bei dem die Tugenden der Aufklärung zur Anwendung kamen (Dahrendorf, 1963). Ralf Dahrendorf hat die USA mal als Land der angewandten Aufklärung bezeichnet, insofern wirkt Kant weiter, aber eher indirekt.
Bibliographie
Bahner W., 1965: Der Friedensgedanke in der Literatur der französischen, in: Grundpositionen der französischen Aufklärung. Hrsg. W. Krauss, H. Mayer. Berlin. S. 139—208.
Beutin W., 1996: Kants Schrift „Zum ewigen Frieden“ (1795) und die zeitgenössische Debatte, in: Hommage a Kant. Kants Schrift „Zum ewigen Frieden“. Hamburg. S. 97—126.
Brandt R., 1996: Historisch-kritische Beobachtungen zu Kants Friedensschrift, in: „Zum ewigen Frieden“, Grundlagen, Aktualität und Aussichten einer Idee von Immanuel Kant. Hrsg. R. Merkel, R. Wittmann. Frankfurt. S. 31—66.
Burke E., 1790: Reflections on the Revolution in France, and on the Proceedings in Certain Societies in London Relative to that Event. In a Letter Intended to Have Been Sent to a Gentleman in Paris. London.
Clausewitz C. von, 1867: Vom Kriege. Hinterlassene Werke über Krieg und Kriegführung des Generals Carl von Clausewitz. In 3 Bde. Dritte Auflage. Berlin.
Dahrendorf R., 1963: Die angewandte Aufklärung. F. a. M.
Dietze A., Dietze W., 1989: Ewiger Friede? Dokumente einer deutschen Diskussion um 1800. München.
Doyle M. W., 1983: Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs, in: Philosophy and Public Affairs. Vol. 12. Nr. 3. S. 205—235; Nr. 4. S. 323—353.
Doyle M. W., 1986: Liberalism and World Politics, in: American Political Science Review. Vol. 80, Nr. 4. S. 1151—1169.
Geismann G., 1982: Kant als Vollender von Hobbes und Rousseau, in: Der Staat. Nr. 21. S. 161—189.
Gentz F. von, 1992: Über den Ewigen Frieden, in: Gentz F. Gesammelte Schriften. Band V. Hrsg. G. Kronenbitter. Hildesheim.
Gentz F. von, 1997: Über den Ursprung und Charakter des Krieges gegen die französische Revolution. Berlin, in: Gentz F. Gesammelte Schriften. Bd. III. Hrsg. G. Kronenbitter. Hildesheim. 1997.
Hoeres P., 2002: Kants Friedensidee in der deutschen Kriegsphilosophie des Ersten Weltkrieges, in: Kant-Studien. Jg. 93. S. 84—112.
Ikenberry G. J., 2001: After Victory. Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars. Princeton.
Kaeber E., 1971: Die Idee des europaischen Gleichgewichts in der publizistischen Literatur vom 16. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Neuauflage. Hildesheim.
Kagan R., 2003: Paradise and Power. America and Europe in the New World Order. London.
Кant I., 1795: Zum ewigen Frieden, in: Kant I. Gesammelte Schriften (Akademie-Ausgabe). Bd. VIII.
Kater T., 1999: Forschungsbericht. Der Krieg, die Republik und der Friede: Zur Rezeption von Immanuel Kants Zum ewigen Frieden, in: Militarismus in Deutschland 1871 bis 1945. Zeitgenössische Analysen und Kritik. Hrsg. W. Wette (Jahrbuch für Historische Friedensforschung. Band 8). S. 327—345.
Montesquieu, C. de, 1992: Vom Geist der Gesetze. Übers. und hrsg. E. Forsthoff. Tubingen.
Raumer K. von, 1953: Ewiger Friede. Friedensrufe und Friedensplane seit der Renaissance. Freiburg/München.
Saint Pierre C.-I. de, 1922: Der Traktat vom ewigen Frieden. Hrsg. W. Michael, F. von Oppeln-Bronikowski. Berlin.
Schumpeter J., 1942: Capitalism, Socialism and Democracy. N. Y.
Stein L. von, 1964: Die Gesellschaftslehre. Erste Abteilung: Der Begriff der Gesellschaft und die Lehre von den Gesellschaftsklassen. Hier zitiert nach Neuausgabe. Osnabrück.
Die erste Veröffentlichung des Aufsatzes:
Joachim Krause. Kant und seine Zeit — die Schrift „Zum ewigen Frieden“ vor der Hintergrund der Französischen Revolution und der nachfolgenden Kriege// Kant’s Project of Perpetual Peace in the Context of Contemporary Politics : proceedings of international seminar/ ed. by A. Zilber, A. Salikov. — Kaliningrad : IKBFU Press, 2013. S. 9 – 23.